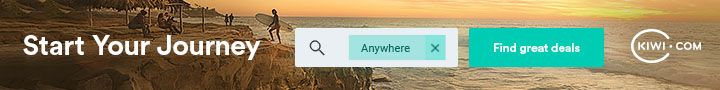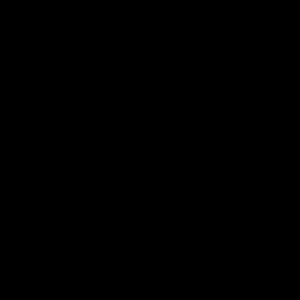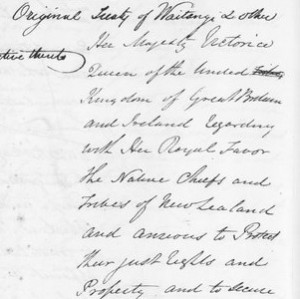Dem gewogenen Leser wird aufgefallen sein, dass das polynesische Erbe Neuseelands bisher ein wenig kurz geraten bzw. schlecht weggekommen ist. Das hat mit meinem Erfahrungsschatz (und dem vieler anderer Kiwis) zu tun, in dem die Polynesier im wesentlichen nur dann auftauchen, wenn es um Kriminalität und Sozialhilfeabhängigkeit geht. Positiv fallen die großen schweren Männer im öffentlichen Leben eigentlich nur im berühmten „All Blacks“ Rugby Team der Neuseeländer auf.
Das ist natürlich zu kurz gegriffen.
Geografisch liegt kein Land der „westlichen Welt“ – wobei ich den Terminus wegen der schnell fortschreitenden Multikulturalisierung eigentlich kaum noch nutzen mag – näher an den Quellen vieler Träume von palmengesäumten Stränden, kristallenem Wasser, ewig warmen Wetter und schönen glücklichen Menschen: Tahiti, Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu usw. Auckland ist de facto die Hauptstadt Polynesiens, und die wichtigste neuseeländische Fluglinie, Air New Zealand fliegt all die wohlklingenden Inselgruppen regelmäßig an. Trotzdem sind bei den Kiwis eher die ausgelutschten und viel weiter entfernten Destinationen wie Bali oder die verbauten Badestrände Australiens (Gold Coast, Sunshine Coast etc) wesentlich beliebter als die Tahitis, Samoas und Tongas dieser Welt. Warum?
Nun zunächst mal wegen der Imagefrage, siehe oben. Wenn z.B. Tonganer und Samoaner als Gangster bekannt sind, warum sollte man dann in der zentralen Räuberhöhle auch noch seinen Urlaub verbringen? Logisch gedacht, und doch nicht richtig, denn ein entwurzelter Exil-Tonganer in Auckland ist nicht dasselbe wie ein Tonganer in seiner Heimat. Schauen wir uns die deshalb mal näher an.
Um der Langatmigkeit vorzubeugen, zur Abwechslung keine umfangreichen Statistiken. Zur Zeit leben etwa 100.000 Tonganer in den Heimatinseln, die meisten, etwa 70.000 auf der Hauptinsel Tongatapu, der Rest verstreut auf den Nebengruppen Ha’apai, Vavau usw. Die Zahl der Exiltonganer kennt niemand genau, aber sie werden etwa auf 150.000 geschätzt, vor allem verteilt in Neuseeland, Australien und den USA. Die Anzahl der Touristen die jährlich Tonga besuchen, liegt bei etwa 40.000, wobei die Aussagekraft dieser Zahl umstritten ist, da sie auch Exiltonganer (mit nicht-mehr-tonganischer Staatsangehörigkeit) umfasst, die sich längst anderswo niedergelassen haben, aber ab und zu die Familie in Tonga besuchen. Echte Touristen sind es wahrscheinlich nur ein paar Tausend pro Jahr. Mallorca, im Vergleich, beherbergt jährlich etwa 10 Millionen Besucher.
- Pazifischer Sonnenuntergang
- Tonga blowhole
Mit anderen Worten, obwohl Tonga die am nähesten an Neuseeland gelegene tropische Inselgruppe ist (2,5 Stunden Flug), sind die Touristenströme minimal. Dementsprechend präsentiert sich Tonga. Zu meiner großen Überraschung existiert die verklärte Südseeatmosphäre tatsächlich noch. Die Bilder Paul Gauguins von polynesischen Schönheiten, die sich lässig auf dem Boden räkeln sind auf Tonga noch heute selbstverständlich. Womit wir bei einem weiteren Grund für die Tourismuszurückhaltung angekommen sind: mangelnde touristische Infrastruktur.
Es gibt natürlich Hotels, Restaurants und sogar „Resorts“, aber deren Dichte ist mit der anderer touristischer Zentren nicht zu vergleichen. Und natürlich ist das der Grund, warum Tonga mich anzieht. Ich finde das permanente Stolpern über Bars, Restaurants und die Strandstühle diverser Hotels entlang der verbauten Strände anderer Tourismusdestinationen uninteressant. In Tonga dagegen führt ein Strandspaziergang meistens an den Anwesen ‚gewöhnlicher‘ Tonganer vorbei, man trifft im Wasser tobende Kinder, und „spear fisher“ also Leute, die mit Schnorchel und Speer unterwegs sind, um sich das Abendessen zu jagen, und deren Fang meist an einer Schnur von deren Hüften baumelt. Ich wurde in Tonga nie in irgendeiner Weise von „beach boys“, Bettlern oder Schlimmerem belästigt, im Gegensatz z.B. zu Bali wo man ständig angemacht wird, und anscheinend alles zum Verkauf steht von Sex mit Kindern bis hin zu harten Drogen.
Am Markt in Nuku’alofa kleben meistens Preise an den Verkaufsartikeln, und die sind meistens zu hoch, aber nicht doppelt, dreifach oder mehr wie z.B. in Indien üblich, wo Preisschilder unbekannt sind, und man, um sich einen Überblick zu verschaffen, sofort mit geschwätzigen bis penetranten Händlern ins Gespräch kommen muss. Ein wenig Handeln reicht in Tonga, um einen fairen Preis zu erzielen, wobei es mir nichts ausmacht 20 oder 30% mehr zu zahlen als die Einheimischen – schließlich liegen Dimensionen zwischen den entsprechenden Einkommen. Ich habe übrigens nie verstanden, warum so viele Touristen lächerlich hohe Preise für ihre Hotelübernachtungen ohne Murren hinnehmen, aber dann beim Einkauf lokaler Produkte feilschen wie die Pferdehändler. Mir geht es darum, nicht hoffnungslos über den Tisch gezogen zu werden, da das meines Erachtens einem Mangel an Respekt Fremden gegenüber gleichkommt, und ich so eine Einstellung nicht unterstützen mag. Wie auch immer, in Tonga ist das weitgehend kein Thema – aber man sollte natürlich immer mitdenken.
Der Markt führt uns auch zu meiner letzten These, was den touristischen Dornröschenschlaf Tongas betrifft. Denn auf dem Markt ist es offensichtlich, dass die Tonganer von Chinesen aus dem Geschäftsleben verdrängt werden. Die Chinesen sind vor allem durch den Verkauf von Staatsangehörigkeiten auf Betreiben des Königshauses Tongas ins Land gekommen, und haben sich inzwischen fest im Handel etabliert. Als die Opposition Tongas den Verkauf von Staatsangehörigkeiten vor das Verfassungsgericht brachte und er tatsächlich als Verfassungsbruch gestoppt wurde, wichen die tonganischen Behörden auf den Verkauf von Daueraufenthaltsgenehmigungen aus, die nach 5 Jahren in Staatsangehörigkeiten umgewandelt werden können. Von dem Erlös der Staatsangehörigkeitsverkäufe scheint indes wenig beim Tonganer auf der Straße angekommen zu sein. Das meiste, so wird hinter vorgehaltener Hand vermutet, landete auf den Schweizer Bankkonten der Königsfamilie. Davon unbenommen, ist die Übernahme des Geschäftslebens durch Chinesen vielen Tonganern ein Dorn im Auge (während analoge Vorgänge in Neuseeland die meisten Kiwis nicht zu tangieren scheinen). Dieser Unmut verschaffte sich 2006 in Tonga Luft, als während gewalttätiger Unruhen chinesische Geschäfte geplündert und in Brand gesteckt wurden. Politisch korrekt lässt sich das kaum noch aufarbeiten. Aber man kann es ja versuchen. Das Resultat sind dann verquaste Aussagen wie z.B. im Allerheiligsten der politisch korrekten Tourismusszene, der „Lonely Planet“ Reiseführer-Serie. Als ich vor Jahren in Tahiti war, fiel mir auch dort auf, dass selbst im kleinsten Laden der entlegensten Insel Chinesen hinter den Tresen standen, die insgesamt nur einen kleinen Teil der Bevölkerung stellen. „Lonely Planet“ erklärte das dadurch, dass die Chinesen nun mal eine geschäftstüchtige „Community“ seien, und den Polynesiern dadurch ja nur helfen würden. Der implizite Rassismus, den Polynesiern Geschäftssinn abzusprechen, fiel den Autoren anscheinend nicht auf. Auch für die asiatische Übernahme der Innenstadt von Auckland hat „Lonely Planet“ eine politisch glatte wie unglaubwürdige Erklärung parat. Das von Asiaten geprägte Bild der Innenstadt wird dadurch weg erklärt, dass die meisten schließlich nur Studenten seien. Soll heißen, die bleiben nicht auf immer, und man sollte sie deshalb nicht zählen. Die Realität ist allerdings die, dass diese Studenten ungefähr so temporär in Neuseeland sind, wie seinerzeit die türkischen Gastarbeiter es in Deutschland waren. Viele Colleges in Neuseeland sind im wesentlichen nur „immigration scams“, Organisationen zu dem Zweck gegründet, Chinesen, Indern und anderen Visa als Studenten zu verschaffen, um ihnen dann später zu gestatten, sich als „Fachkräfte“ um Daueraufenthaltsgenehmigungen zu bewerben. Viele der Colleges werden deshalb auch von Chinesen und Indern betrieben. Man kann dort ein ‚Diplom‘ als Homöopath, Friseur oder Koch erwerben, gegen sehr gutes Geld, das de facto einer Eintrittsgebühr nach Neuseeland gleichkommt.
Zurück zu den Rassenunruhen in Tonga. Egal ob hier, oder in Fiji, die schmutzigen Geschäfte, die unter dem Mäntelchen des ehrwürdigen Traums von multikultureller Harmonie getätigt wurden, haben das ohnehin schon nicht wohlhabende oder besonders gut geführte Land um ein explosives Spannungsfeld reicher gemacht. Auch ohne ethnische Spannungen gibt es genug Armut in Tonga. Wer sich davon überzeugen möchte möge „Old Tonga“ im Süden von Nuku’alofa besuchen, und bei der Fahrt dahin (einen Spaziergang würde ich niemandem anraten) nicht wegschauen. Der Weg dorthin führt durch „The Hood“. Die Hütten werden immer karger, der Müll immer mehr, der Gestank ebenso. Man fühlt sich in ein indisches Slum katapultiert.
Der Standard sind Elendsviertel, meiner Beobachtung nach, allerdings nicht. Die meisten Tonganer leben in einfachen Hütten, von einem Garten und landwirtschaftlich nutzbaren Flächen umgeben, wobei der Garten penibel in Ordnung gehalten wird (mehr als die Häuser und Hütten), da die Rasenflächen als zusätzliches Freiluftzimmer genutzt werden, zum geselligen Sitzen und Tratschen, wie das schon Gauguin zu seiner Zeit im Bild festgehalten hat.
- Ha’atafu Beach Tonga
- Typisches Haus in Tonga
Es wird vielfach auf Selbstversorgung gewirtschaftet. Hühner, Schweine und Ziegen gehören zum ländlichen Straßenbild, wie auch teils riesige Mango- und Brotfruchtbäume, und allerlei tropischer Ackerbau, wie zum Beispiel Taro- und Kokonussplantagen. Dazu kommt noch etwas Fischfang, und die Herstellung bzw. der Verkauf von kunsthandwerklichen Produkten, wie Tapa (aus der Rinde des Maulbeerbaums gewonnene, manchmal bemalte Matten), Holzschnitzereien und aus Meeresmuscheln gefertigter Schmuck. Für ein einfaches Leben scheint das für die meisten zu reichen – wobei ‚einfach‘ nicht ganz klar zu definieren ist, da Tonga – gemeinsam mit einigen andern polynesischen Inselgruppen – den Weltrekord an Fettleibigkeit und damit zusammenhängenden Krankheiten, besonders Diabetes, hält, was eher auf Exzesse als Spartanisches hindeutet. So kann sich auch Tonga nicht der Globalisierung der Ideen verschließen. Internet und Satellitenfernsehen sind zwar noch nicht überall angekommen, aber sie sind weit genug verbreitet, um Konsumbegehrlichkeiten zu wecken, incl. Grillhuhn und Coca-Cola, aber auch Autos oder extravagante Häuser. Das erklärt die vielen meist handgemalten Reklamen am Straßenrand à la „Aloha Financial Services“. Das sind ganz ordinäre Geldverleiher. Sicherheiten werden oft in Form von Tapa und anderen handwerklichen Produkten hinterlegt, und meistens kommt es auch zur Vollstreckung dieser Sicherheiten wegen der happy-go-lucky Mentalität der Tonganer, die glauben, dass sich das Geld für die Rückzahlung schon finden wird, auch wenn das rational gedacht noch so unwahrscheinlich sein mag. Sinn macht die Prozedur für die Schuldner keineswegs. Würden sie ihre Tapa direkt verkaufen, würde ihnen das ein Vielfaches des Kapitals bescheren, das sie als Sicherheit verbürgten. Die Gläubiger freuen sich umso mehr – bahaupte also niemand der Polynesier verstünde die hohe Kunst der Abzocke nicht. Die Tapa landen letztlich oft in Neuseeland (wo sie im allgemeinen immerhin nicht als Maori Originale gehandelt, sondern als tonganisch deklariert werden) und in Hawaii, als authentisch hawaiianisches Kunsthandwerk.
- Nuku’alofa: letzter Schultag
- Tonga girls
Der Glaube, dass alles irgendwie schon klappen wird, geht anscheinend auch Hand in Hand mit einer weitgehend leidenschaftlichen christlichen Religiosität. Wer kann, sollte unbedingt einem sonntäglichen Gottesdienst beiwohnen. Es wird mit einer Inbrunst gesungen, die uns – die alles und jedes versuchen mit Geld zu erklären – völlig abhanden gekommen ist. Diese Menschen beim Gottesdienst zu beobachten, war für mich ein Schlüsselerlebnis in Tonga. Trotz meiner (relativ) guten Kleidung und anderer Habe, um die mich viele Tonganer sicherlich beneideten, fühlte ich mich ein wenig … arm. Die Wucht und Ästhetik eines kindlichen Glaubens gehören zu den Schätzen dieser Menschen. Wie man auch zu den Missionaren stehen mag, die das Christentum nach Tonga gebracht haben, so finde ich es schwer zu glauben, dass das Christentum ausschließlich Schlechtes bewirkt hat. In gewisser Weise dient der christliche Glaube den Tonganern als emotionales Reservat, in dem alte Traditionen in neuer Form überleben können. Andererseits ist es natürlich amüsant zu sehen, wie die Menschen in Tonga oft voll bekleidet im Meer plantschen, aus einer falsch verstandenen Scham heraus. By the way, führt diese Angewohnheit zu Problemen in Neuseeland, denn die Kiwis sehen es nicht gerne, wenn Tonganer in öffentlichen Schwimmbädern in voller Bekleidung ins Bassin steigen. Päpstlicher als der Papst sind die Tonganer nun aber auch nicht. So sind werden Familienarrangements sehr locker interpretiert. Der Sohn ist manchmal eigentlich der Enkel, und der Bruder der Onkel. Auf diese Weise werden die Resultate von „Fehltritten“ einfach umgedeutet, und ganz normal. Ganz normal menschlich. Ob der Vatikan die allseits beliebten Kava-Abende gut heißen würde, kann man auch bezweifeln. Kava ist eine stimmungsaufhellende in der Südsee verbreitete „Droge“. Und dann gibt es da noch die Bestattungsrituale. Gräber werden zumeist nicht auf Friedhöfen gegraben, sondern auf dem eigenen Grundstück. Und die Grabdekoration erinnert an die Vorlieben des oder der Verstorbenen, auch wenn es sich um Bierkonsum handelte.
- Polynesisches Grab
- Grabkranz im Tongastil
Um nochmal kurz auf den Reflex zur Verteufelung allen westlichen Einflusses zurückzukommen … den teile ich nicht. Natürlich wäre es schöner in ein Land zu reisen, das ‚ursprünglich‘ ist. Schön und unrealistisch. Auch Neuseeland muss fantastisch gewesen sein, bevor Menschen dort ankamen. Hier allerdings ein Gegenentwurf. Die polynesische Odyssee begann – nach dem Dafürhalten von Experten – auf der Insel die wir heute als Taiwan kennen. Dort leben heute noch polynesische Ureinwohner (die Chinesen ‚entdeckten‘ Taiwan erst im 16. Jahrhundert), zumeist in entlegenen Bergtälern, und kleinen vorgelagerten Inseln, wie z.B. der Stamm der Ami. Im Gegensatz zu den Bewohnern Tongas, die ethnisch relativ intakt erscheinen, wo es also zu keiner intensiven Vermischung gekommen ist, kann man die polynesische Herkunft der taiwanesischen Aborigines (so ihre offizielle Bezeichnung) von ihrem äußeren Erscheinungsbild her nur noch erahnen. Die Regierung Taiwans bezeichnet die Aborigines in offiziellen Schriftstücken noch immer als zurückgeblieben, und stur auf überkommene Traditionen beharrend und sich der Modernisiering (= Sinisieriung) verschließend. Die gesellschaftliche Marginalisierung der Aborigines hält ebenfalls bis dato an. Wegen der – noch immer vorhandenen – außergewöhnlichen Schönheit der Frauen, enden diese oft in der Prostitution, was dann in der chinesischen Mehrheitsbevölkerung wiederum zu vermehrter Stigmatisierung führt. Wo würden heute die Tonganer stehen, wären sie nicht unter westlichem, sondern chinesischen Einfluß geraten? Im übrigen genießt Tonga noch die Sonderstellung, nie eine Kolonie gewesen zu sein. Mit Deutschland pflegt Tonga gar seit 1876 einen Freundschaftsvertrag, und Deutschland ist bis heute bei der Entwicklungszusammenarbeit mit Tonga stark engagiert. Wie üblich bringen die Deutschen die Geschenke, und die Chinesen machen die Geschäfte, und stellen sich noch ein nagelneues palastartiges Botschaftgebäude in Nuku’alofa hin, um klar zu machen woher der neue Wind weht.
So ganz angekommen ist der chinesische Drache in Tonga aber noch nicht. Die tonganische Jugend scheint noch immer eher auf amerikanischen Krimskrams geeicht, inklusive Baseballkappen und -shirts, und den Los Angeles Gangsta-Look. Ob sich hinter den getönten Sonnenbrillen tatsächlich potentielle Kriminelle, oder nur cool spielende Jugendliche verstecken, habe ich zugegebenermaßen nicht ausprobieren wollen, sprich ich habe mich von entsprechenden Menschentrauben ferngehalten.
Last, but not least, noch ein paar praktische Tipps. Wie auf entlegenen Inseln ohne industrielle Basis üblich, wird praktisch alles, bis zur letzten Schraube importiert, und ist entsprechend teuer, oder gar nicht erst zu haben. Deshalb sollte man Dinge wie Sonnencreme, Moskitonetz (wichtig!), Strandschlappen, Schnorchelausrüstung usw. am besten mitbringen, anstatt lange vor Ort danach zu suchen.
Transport auf der Hauptinsel funktioniert per Bus ganz gut, aber es gibt keine festen Fahrpläne, und die letzten Busse des Tages von Nuku’alofa in die verschiedenen Winkel der Insel fahren relativ früh am Nachmittag ab, und sind oft gerammelt voll. Aber die Busse sind sauber, und es herrschen zivilisierte Gepflogenheiten. Alternativ kann man sich ein Auto sehr günstig leihen. Allerdings spotten die Vehikel jeglicher Beschreibung. Ich habe noch nie üblere Wracks auf der Straße gesehen. Die Fresskette funktioniert wie folgt: ein neues japanisches Auto wird in Japan gefahren, bis es keiner mehr haben will. Danach geht es auf Reisen nach Neuseeland, wo es weiter geschrubbt wird. Wenn auch dort sein Use-by Datum abgelaufen ist, kommt es zur finalen Verwertung nach Tonga. Auf alle Fälle beim Autofahren besonders vorsichtig sein, vor allem nach Sonnenuntergang, wegen der vielen Kinder und Tiere in den Straßen. Transport zwischen den Inselgruppen ist nicht einfach. Wenn man auf ‚island hopping‘ aus ist, dann entweder schon im voraus planen und buchen, oder genug Zeit mitbringen, um sich z.B. per Fähre zu bewegen, statt sündteuer island per Flugzeug zu hüpfen. Am besten ist es natürlich mit der eigenen Yacht zu kommen, aber dazu ein andermal mehr.
*** *** ***
Lust auf Südsee? Mit KIWI.com kann man sich die Flüge nach Neuseeland und Tonga selbst zusammenstellen (Option „Mehrere Flughäfen“ und z.B. Frankfurt – Auckland – Nuku’alofa eingeben):